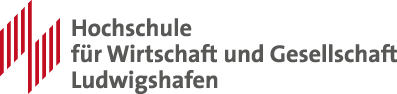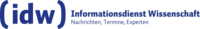Die achten Ludwigshafener Bildungsgespräche widmeten sich im November 2019 den Future Skills Medienkompetenz und Data Literacy und brachten Hochschullehrende, Mitarbeitende und Forscher*innen aus ganz Rheinland-Pfalz zusammen. Der erste Teil der Veranstaltung ermöglichte einen schnellen Einstieg in die Themen: Mit Dr. Marco Kalz, Professor für Mediendidaktik an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, und Dr. Jens Heidrich vom Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering IESE stellten zwei ausgewiesene Experten den aktuellen Forschungsstand zu diesen Kompetenzen vor. Ausgehend von der Digitalen Gesellschaft, die digital kompetente Bürgerinnen und Bürger benötigt – „Being digitally competent means using digital technologies in a confident and safe way for various purposes such as working, getting a job, learning, shopping online […] “ (European Commission 2019) – zeigte Kalz anhand mehrerer Konzepte für ICT- und Medienkompetenzen die große Bandbreite an Definitionen auf. Der Digicomp Framework 2.1 der Europäischen Kommission sieht Kommunikation und Zusammenarbeit, Erstellung digitaler Inhalte, Sicherheit, Problemlösung und Information und Data Literacy als wichtige Aspekte von Medienkompetenz. Damit sind erste Schnittstellen zur Data Literacy sichtbar.
„Data Literacy ist die Fähigkeit, Daten auf kritische Art und Weise zu sammeln, zu managen, zu bewerten und anzuwenden“ (Ridsdale et al. 2015). – Dr. Jens Heidrich reflektierte diese Definition in seinem Vortrag und zeigte die Schnittmengen zu Information Literacy oder Data Science auf. Data Literacy etablierte sich als Konzept in der deutschsprachigen Community erst in den letzten Jahren. Sie umfasst auf der einen Seite eine so genannte ‚codierende Komponente‘, in der Studierende ähnlich eines quantitativen Forschungsprozesses Daten erfassen, Daten auswerten und grafisch sowie verbal darstellen. Die decodierende Begriffskomponente fokussiert auf die Arbeit mit den grafisch und verbal aufbereiteten Daten. Diese Ergebnisse und Daten werden von Studierenden interpretiert und Handeln abgeleitet (Überblick s. Stifterverband / Framework für Data Literacy). Data Literacy verfolgt dabei zwei Zwecke: entweder den Umgang mit Daten in der Disziplin mit einer stärkeren Tiefe und Komplexität oder einen breiten Grundstock an Kompetenzen für mündige Bürgerinnen und Bürger. Die Qualifizierungsangebote der Hochschulen unterscheiden sich je nach Zweck stark.
In den anschließenden Workshops diskutierten die Teilnehmenden über die Integration der Kompetenzen in die Curricula. Professor Dr. Marco Kalz und Mathias Bandtel (Projekt modal, Hochschule Mannheim) unterstützen diese Überlegungen durch Beratung und Good-Practice-Beispiele. Überlegungen zur Integration von Medienkompetenzen in die Curricula umfassten beispielsweise die Implementierung eines zentralen Medienzentrums, das Angebot eines interdisziplinären Querschnittmoduls und die verstärkte Nutzung von digitalen Medien in Unterricht und Prüfung (z.B. Erstellung von Videos).
Im Workshop zu Data Literacy konnten sich die Teilnehmenden vorstellen, die Kompetenzen in vorhandene Module stringenter einzubringen und sichtbar zu machen. Insbesondere in den BWL-Studiengängen sahen sie viele Anknüpfungspunkte im Bereich Statistik, Soft Skills oder für die Arbeit mit Datensätzen in Projektseminaren. Interdisziplinäre Team-Projekte oder ein fachbereichsübergreifendes Wahlmodul könnten ebenfalls Data Literacy vermitteln. Weitere Ideen waren Ringvorlesungen oder kollegiale Beratungen für Hochschullehrende, um sich mit dem Konzept, den Kompetenzen und Vermittlungsideen besser vertraut zu machen. Open Educational Ressources liefern hierfür zukünftig Projekte zur Entwicklung von Data Literacy-Modulen, die der Stifterverband derzeit fördert.
Die Vortrags-Videos finden Sie hier
Fachkontakt:
Dr. Imke Buß
Studium & Lehre
Tel. 0621/5203-254
imke.buss@ 8< SPAM-Schutz, bitte entfernen >8 hwg-lu.de